Schönheit ist unschuldig – so ungefähr muss sich das der Anwalt gedacht haben, als er der schönen Phryne vor versammeltem Gericht das Gewand vom Körper riss. Nackte Tatsachen zur Beweisführung. Die Angeklagte selbst scheint von der Strategie ihres Verteidigers nur mäßig überzeugt und verbirgt verschämt das Gesicht. – Alte Männer, die auf Brüste starren! Heute schrillen da alle MeToo-Alarmglocken. Aber vielleicht ist es doch anders, als es auf den ersten Blick scheint . . . Der Reihe nach.
Phryne kam vor das hier dargestellte Gericht, den obersten Rat in Athen, wegen Gotteslästerung. Da war sie bereits eine gemachte Frau. Sie hatte bemerkt, wie sie aus der eigenen Schönheit Kapital schlagen konnte und mit dem Geld der ihr verfallenen Männer einen mächtigen sozialen Aufstieg hingelegt, von der einfachen Kapernhändlerin zur Grande Dame. Den Bildhauer Praxiteles jedenfalls soll der Anblick der nackt ins Meer steigenden Phryne zu seiner marmornen Aphrodite von Knidos inspiriert haben. Und so landete Phryne als Göttinnen-Skulptur im Tempel auf der Insel Knidos, worin Neider den lästerlichen Anspruch sahen, sie wolle sich selbst zur Göttin erheben.
Damals eine Sensation
Vielleicht war die Anklage aber auch nur der verzweifelte Versuch eines verprellten Liebhabers, sich auf juristischem Umweg an Phryne zu rächen. Viel geben die antiken Quellen über den aufsehenerregenden Prozess vor dem Athener Altherren-Gericht nicht her. Zum Glück für Kunst und Legende! Denn so dürfen sich die Geister bis heute an der Geschichte abarbeiten.
Einer von ihnen war der französische Maler Jean-Léon Gérôme. Seine "Phryne vor den Richtern" von 1861 galt als kleine Sensation im Pariser Salon. Jean-Léon Gérôme war ein vielbeachteter Künstler, der den Betrachtern seiner opulenten Leinwandschinken die willkommene Möglichkeit bot, sich unter dem Vorwand des Bildstudiums viel nackte Haut anzuschauen – sei es auf seinen detaillierten Darstellungen orientalischer Damenbäder und Harems oder eben bei Phryne. Da war der reflexhafte Pornografie-Vorwurf an den Maler natürlich nicht weit.
Adele zeigt ihren Brüsten die Männer
Aber schon damals galt: Auch schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten, Hauptsache man ist im Gespräch. Je mehr sich die Kritiker echauffierten, desto mehr Menschen interessierten sich für die vermeintlichen Pornos mit antikem Sujet. Es braucht allerdings nicht viel Wohlwollen, um zu erkennen, dass Jean-Léon Gérôme auch noch andere Intentionen hegte als die Befriedigung verheimlichter Bedürfnisse und die Erregung öffentlicher Ärgernisse.
Klar, das Bild lässt sich als lüsterne Zurschaustellung einer jungen Frau deuten. Aber trifft es das? Von der Anordnung ist die Aufmerksamkeit eigentlich auf die Männer des Areopags gerichtet. Sie werden in ein moralisch zweifelhaftes Licht gerückt – und zwar wortwörtlich, schließlich sitzen sie im Schatten. Die Männer glotzen gebannt, erschrocken, erstaunt. Und die Betrachter des Bildes glotzen auf die Glotzenden. Ertappt. Am besten kommt in diesem Arrangement die Phryne weg. Sie erhält sogar göttliche Unterstützung. Die kleine goldene Figurine in der Bildmitte, die Stadtgöttin Athene in ihrem Harnisch, scheint die Angeklagte regelrecht zu verteidigen.
Für die Angeklagte ging es gut aus
Hat Jean-Léon Gérôme hier schon mal angemalt, was der Karikaturist Friedrich Karl Waechter ein paar Jahrzehnte später augenzwinkernd zu einer feministischen Selbstermächtigung machte? Er griff das Phryne-Motiv auf und schrieb darunter: "Adele zeigt ihren Brüsten die Männer." So lässt sich das wohl auch sehen. Unabhängig davon, wer hier wen anschaut: Für die Angeklagte endete der Prozess glücklich. Wer so schön ist, kann kein schlechter Mensch sein, entschieden die Richter und sprachen Phryne frei.



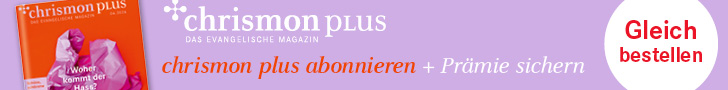
Neuen Kommentar hinzufügen