Zum Glück muss ich diese begeisterungstrunkene Behauptung nicht ausführlich begründen. Ich kann es mir einfach machen und allen, die diese Zeilen lesen, eine große Freude bereiten, indem ich sie auf die lange Novalis-Nacht hinweise, die Burkhardt Reinartz für Deutschlandfunkkultur gestaltet hat. Man muss nur hier anklicken, sich eine längere Muße gönnen, dann wird man alles darüber erfahren, warum dieser romantische Avantgardist immer noch so inspirierend ist: als Dichter natürlich, aber auch als Naturforscher, Zeitgeistdenker, Philosoph und nicht zuletzt als – wenn auch ganz unorthodoxer – Theologe.
In der letzten der drei Stunden zeigt Reinartz, welche modernen Autoren sich direkt oder indirekt von Novalis haben anregen lassen. So unterschiedliche Autoren wie Hans Magnus Enzensberger, Marica Bodrožić, Rolf Dieter Brinkmann („Ich gehe in ein anderes Blau“) oder die US-amerikanischen Beat-Autoren sind dabei. Ich dachte beim Hören an einen Dichter, dessen letztes Buch ich zufälligerweise gerade lese. Auch er hat die programmatische Idee von Novalis fortgeführt, dass das Leben romantisiert werden müsse.
Philippe Jaccottet ist viel älter geworden, als es Novalis vergönnt war. Er hat nicht nur 28, sondern 95 Jahre gelebt! Erst im vergangenen Jahr ist er verstorben. In seiner späten Prosa („Die wenigen Geräusche“, 2020) aber tut er als Greis genau das, was Novalis als Jüngling proklamiert hat (er hat dessen Werk übrigens gut gekannt und dessen „Hymnen an die Nacht“ ins Französische übersetzt, wenn ich das richtig recherchiert habe). Jaccottet schaut die Welt in ihrer Schönheit und Kostbarkeit an und verwandelt sie, indem er darüber schreibt. Besonders die kurzen Notate über seine letzten Spaziergänge, die er von seinem Zuhause im südfranzösischen Dorf Gignan aus unternommen hat, zeugen davon. Da geht einer hinaus, betrachtet, was ihm begegnet, erkennt auch im Unscheinbarsten einen Zauber und schreibt davon so, dass die Wahrnehmung der Welt entgrenzt wird.
Zum Beispiel so:
„Und in diesem letzten Sommer, vielleicht weil ich weiß, dass ich selbst im besten Falle nicht mehr so viele vor mir habe ..., haben gewisse Dinge dieser Welt mich mehr erstaunt denn je, haben mehr Relief bekommen, mehr Intensität, mehr Gegenwart; auch mehr, was soll ich sagen?, Wärme.“
„Spaziergang bei Paulhiet, in einem außergewöhnlich durchsichtigen Februarlicht. Hohe Kastanien, viele von ihnen halb abgestorben, strohfarbene Schluchten..., ein paar Spaziergänger, ein Bauer auf seinem Traktor, Eindruck, in der Schwebe zu hängen...: Kargheit ohne Armut, Sanftheit ohne Süße.“
„Spaziergang auf der Straße von Salles zur Berre, bei sehr mildem und sonnigem Wetter... entlang der Berre...: ein Trampelpfad, zahlreiche umgestürzte Bäume, abgebrochene Äste, in heller Farbe, durcheinander, Eindruck von verlassenen, nie betretenen Orten, wo Veilchen sprießen und Priemeln in ihrer seltsamen Farbe, blassgelb, fast grünlich, als suchten sie sich nicht allzu sehr zu unterscheiden von den Blättern... Farbe, aber kein Licht. Eindruck von ‚Freundlichkeit‘ (?), vorausgesetzt, man nimmt diesem Wort alles Niedliche. Und dabei wie immer die Gewissheit, man darf nicht allzu weit in der Ferne suchen.“



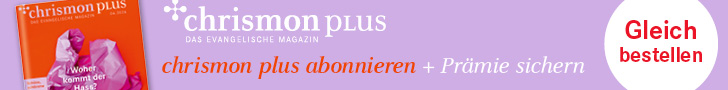
Gefühle in der Mühle.
Die Romantik ist nur das rosarote Licht im Freudenhaus des Lebens. Sie ist die emotionelle Droge, die vorgibt, uns vor dem Bösen der Welt schützen zu können. Romantik kann sich nur leisten, wer sonst keine Probleme hat. Romantik ist eine teure Emotion. Wer "Kohlen schaufeln" muss, kann nicht in höheren Sphären schweben. Romantik war als eine erlebbare Ersatzreligion gedacht. Nach der Aufklärung flüchteten die Religionsmüden in eine romantische Ersatzwelt. Ihre Engel und Elfen die Bachblüten, Astrologie und Horoskop ihre Hoffnung, Yoga ihr Gebet und Geld ihr Rettungsanker. Wer hat der hat. Wer nichts hat, hat nichts als das hilflose Nachsehen und das Jenseits der Romantik erreicht. Aber immer noch besser als von Beginn an Trostlosigkeit.
romantik
Dem widerspreche ich gern. Die recht verstandene Romantik steht für ein Menschenrecht oder für die Menschenwürde schlechthin, nämlich die Fähigkeit, über sich selbst hinaus zu denken, zu empfinden, zu streben. Diese armen Menschen abzusprechen, kann nicht richtig sein. Zugleich aber folgt aus einem romantischen Menschenbild á la Novalis auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Womit man bei Georg Büchner wäre.
Dem widerspreche ich nicht.
Dem widerspreche ich nicht. Fatal wird nur, wenn die Romantik, bzw. zu was sie persönlich mutieren kann, zur Betäubung von Realitäten und zur Bewusstseinsverschleierung führt. Von der literarisch rein schöngeistigen Begriffsdefinition aus haben Sie sicherlich recht, aber in der Breite hat sich der Begriff bzw. Zustand auf profanen Ebenen festgesetzt. Die "Romantik" des Volkes ist nicht die der Literaten.
Neuen Kommentar hinzufügen