Wolfram Gössling im April 2013
Rania Matar
Onkologe mit Krebs
"Ich weiß, was es heißt, verwundbar zu sein"
Wolfram Gössling ist Krebsspezialist in Harvard. Vor einigen Jahren ist er selbst an Krebs erkrankt. Hier erzählt er von der Therapie, von Ängsten - und was er gelernt hat für die Arbeit mit seinen Patienten
chrismon: Sie sind zweimal an einem extrem gefährlichen Tumor in der Gesichtshaut erkrankt. Vor der Strahlentherapie sagte Ihr behandelnder Arzt, mit dem Sie auch befreundet sind: "Die Behandlung wird hart, ich bringe dich an den Rand des Abgrunds, lasse dich dort baumeln, dann hole ich dich zurück und bringe dich in Sicherheit." Würden Sie das auch zu einem Ihrer
Registrieren und weiterlesen
Werden Sie Teil der chrismon-Community!
Ihre Vorteile:
Sie lesen weiter kostenlos unsere Reportagen, Interviews, Dossiers und vieles mehr
Sie profitieren von unseren kostenlosen Webinaren
Sie erhalten unsere Newsletter „mittendrin“ und „chrismon am Wochenende“
Leseempfehlung
Anleitung für die Sprechstunde
So erreichen Sie, dass Ärzte zuhören
Wer krank ist, braucht ein offenes Ohr. Aber Ärzte hören Patienten oft nicht zu und beschließen Therapien über ihre Köpfe hinweg – manchmal zum Schaden der Patienten. Anleitung für eine Sprechstunde, bei der beide Seiten gewinnen
17



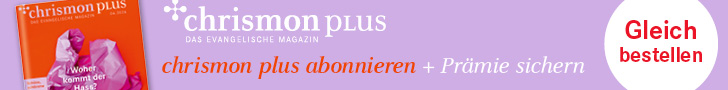
Neuen Kommentar hinzufügen