Blick auf das Kloster Moni Grigoriou auf Athos
Espen Eichhöfer/OSTKREUZ
Pilgern mit Cem Özdemir
Auf dem heiligen Berg
Ein säkularer Muslim in orthodoxen Klöstern: Cem Özdemir war schon oft in Athos. Diesmal sind Freunde dabei, auch chrismon-Autor Gero Günther
Viel ist nicht drin in seinem Rucksack. Ein bisschen Wechselwäsche, eine Regenjacke, eine Wasserflasche und jede Menge Riegel und Snacks. Cem Özdemir reist mit leichtem Gepäck. Und das aus gutem Grund: Er ist als Pilger unterwegs. Bereits zum dritten Mal besucht der Grünen-Politiker den Agion Oros oder Heiligen Berg, wie die Mönchsrepublik Athos auf Griechisch heißt. Ganz privat. Diesmal
Registrieren und weiterlesen
Werden Sie Teil der chrismon-Community!
Ihre Vorteile:
Sie lesen weiter kostenlos unsere Reportagen, Interviews, Dossiers und vieles mehr
Sie profitieren von unseren kostenlosen Webinaren
Sie erhalten unsere Newsletter „mittendrin“ und „chrismon am Wochenende“



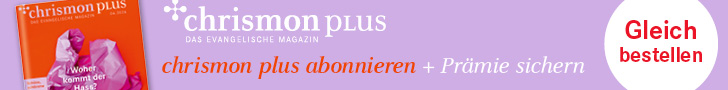
Neuen Kommentar hinzufügen