Mehr als fünf Jahre hat Deutschland mit Namibia über ein Abkommen verhandelt, das den Völkermord an Herero und Nama im kolonialen Deutsch-Südwestafrika 1904-08 anerkennt und eine Bitte um Vergebung mit Finanzhilfen verbindet. Schätzungsweise 80 000 Menschen sind Opfer des Genozids geworden. Im Mai 2021 gaben die Regierungen beider Länder die Einigung bekannt. Die namibische Opposition und besonders Vertreter:innen der Herero und Nama kritisierten, es seien nur handverlesene Repräsentant:innen ihrer Völker einbezogen worden, nicht aber diejenigen, die sich seit langem für eine deutsche Anerkennung der Verantwortung und einen Ausgleich engagierten. Außerdem seien keine Reparationen für Nachfahren der Opfer vereinbart. Die Kritik verdeutlicht, dass Versöhnung eine breite Beteiligung braucht und die Angehörigen der Opfer nicht übergangen werden dürfen.
Sabine Mannitz
2004 hatte die damalige Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul als erstes deutsches Regierungsmitglied "um Vergebung für unsere Schuld" gebeten und betont, Deutschland würde sich in der Entwicklungshilfe besonders für die einstige Kolonie engagieren. Von rechtlicher Anerkennung und Reparationen war keine Rede, so ist es geblieben. Während Nachfahren der Opfer finanzielle Reparation für sich als besonders Geschädigte erwarten, blieb Deutschland darauf bedacht, die Verbrechen anzuerkennen, ohne daraus Rechtsansprüche und finanzielle Pflichten abzuleiten.
Versöhnung mit finanzieller "Wiedergutmachung" zu verknüpfen, ist eine starke völkerrechtliche Gewohnheit. Zwar plädieren in der Kolonialforschung manche für "wiederherstellende Gerechtigkeit", etwa durch Investitionen in Bildung oder Infrastruktur. Aber auch dabei müssen die Nachfahren der Opfer eingebunden sein.
Von Beginn der Verhandlungen an kritisierten Vertreter:innen von Herero und Nama, dass die namibische Regierung sie nur selektiv einbeziehe. Statt diese Spaltungen in Namibia für sich zu nutzen, hätten die Deutschen auf einer inklusiven Strategie bestehen sollen. Das Parlament in Windhuk hat nun die Verabschiedung des Abkommens ausgesetzt: Der Chefunterhändler des Landes und zwei profilierte Kritiker starben nach Corona-Infektionen. Das ist tragisch, zugleich aber eine Chance, in neuen Konstellationen einen weitergehenden Ausgleich zu suchen.



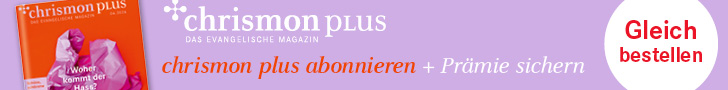
Neuen Kommentar hinzufügen